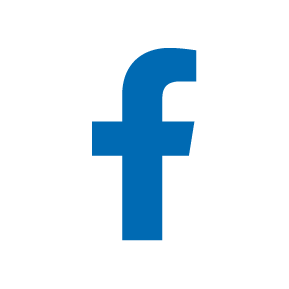News Regio-Interview
07.03.2025
Regio-Interview – Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik im Gespräch
Zehn Fragen an Dr. Maria Lezzi, Direktorin des Bundesamt für Raumentwicklung ARE
Zurzeit läuft auf Bundesebene die Vernehmlassung zum Raumkonzept Schweiz. Was dürfen wir unter einem solchen Raumkonzept verstehen?
Das Raumkonzept Schweiz ist eine Idee, wie die Schweiz 2050 aussehen soll und mit welchen Strategien wir dies erreichen können. Das Besondere daran ist, dass allen drei Staatsebenen gemeinsam diese Idee erarbeitet haben, also Bund, Kantone, Städte und Gemeinden. Wie sieht unsere Idee der Schweiz nun aus? Kurz gesagt: Wir wollen ein vielfältiges Land, in dem man gerne wohnt und arbeitet. Wir gehen sorgsam mit unseren Ressourcen um und entwickeln bestehende Strukturen weiter. Dadurch erhalten wir Gutes und schaffen Raum für Neues.
Welche Chancen bietet ein solches Raumkonzept?
Wir stellen mit dem Raumkonzept die Weichen für die Zukunft. Wo und wie wollen wir leben? Wo ist Platz für die Wirtschaft und die Energieversorgung. Wo ist Raum für die Natur und wo soll Neues entstehen, von dem wir vielleicht noch gar nicht wissen, was ist sein wird? Solche Überlegungen fliessen ein in die Planungsinstrumente. Das bisherige Raumkonzept haben wir zum Beispiel in den Sachpläne des Bundes umgesetzt. Und die Kantone haben kantonale Raumkonzepte auf dem gemeinsamen Raumkonzept Schweiz erarbeitet als Basis für ihre kantonale Richtplanung.
Was sind aktuelle oder auch neue Herausforderungen im Bereich der Raumplanung?
Die erste Fassung des Raumkonzepts von 2012 war davon geprägt, Siedlungen nach Innen zu entwickeln und nicht auf der grünen Wiese zu bauen. Damit sind wir auf Kurs. Die neuen Themen der Raumentwicklung sind der Klimawandel und das Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum. Beides verschärft Konflikte um den Raum, der ja begrenzt ist. Zum einen sind die Ansprüche an den Wohnraum und die Mobilität anhaltend hoch. Es braucht mehr Verkehrsinfrastrukturen und Gebäude. Nicht zu vergessen sind auch die Infrastrukturen für die Produktion, die Speicherung und den Vertrieb von erneuerbaren Energien. Zum anderen müssen wir die Siedlungen an den Klimawandel anpassen, etwa durch Freiräume für Biodiversität, aber auch durch Schutzmassnahmen vor Hitze und Überschwemmungen.
Werden dabei auch die grenzüberschreitenden Räume miteinbezogen?
Noch stärker als bisher setzt das aktualisierte Raumkonzept auf das Denken, das Planen und die Zusammenarbeit über Kantons- und Landesgrenze hinweg. Wir sprechen von sogenannten Handlungsräumen und funktionalen Räumen. Das sind geographische Räume, in denen Wirtschaft, Gesellschaft, Siedlung und Mobilität eng miteinander verflochten sind. Diese Räume enden nicht an Landesgrenzen, wie man zum Beispiel in der Region Basel sehr gut sieht.
Konnten Sie schon erste Eindrücke aus der Vernehmlassung gewinnen oder haben Sie bereits andere Reaktionen erhalten?
Der Bedarf nach einem von allen getragenen, aktualisierten Orientierungsrahmen für den Raum Schweiz ist unbestritten. Was wir bisher hören, sind zu Teil kritische Stimmen: Das Raumkonzept sei zu zahm. So sei es nicht möglich, die Klimaziele zu erreichen. Andere wiederum begrüssen es, dass nicht nur die grossen Zentren betont werden, sondern auch die besondere Struktur der Schweiz, die aus vielen grossen, mittleren und kleinen Zentren besteht. Noch ist es allerdings zu früh für eine Bilanz. Uns ist es wichtig, dass der Entwurf breit diskutiert wird. Nur so können wir ihn noch verbessern und gemeinsam weiterkommen. Ganz im Sinne von Entwerfen, verwerfen, nochmals entwerfen.
Wie geht es nun weiter?
Bis Herbst 2025 werden wir den Entwurf überarbeiten, unter Berücksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen. Sobald die aktualisierte Version steht, wird sie von den politischen Trägern in ihren Gremien verabschiedet. Das wird voraussichtlich Anfang 2026 der Fall sein.
Welchen Stellenwert hat die grenzüberschreitende Zusammenarbeit generell für die schweizerische Raumplanung?
Die grosse Mehrheit der Kantone grenzt an ein Nachbarland. Die grenzüberschreitende Abstimmung und Zusammenarbeit in der Raumentwicklung haben also eine lange Tradition und einen hohen Stellenwert in der Schweiz.
Bräuchte es in Grenzregionen Sonderrecht, um gemeinsam grenzüberschreitenden planen zu können?
Nein. In Sachen Planung brauchen wir keine Sonderrechte, sondern das Interesse und den Willen zur Zusammenarbeit. Es ist hilfreich, wenn die nötigen Daten beidseits der Grenze zugänglich sind. Menschen oder Firmen in Grenzregionen interessiert letztlich, dass Planungen umgesetzt werden – zum Beispiel keine Warteschlagen am Grenzübergang, ein durchgehender Veloweg, ein einfaches öV-Ticket auch in den Nachbarländern, genügend bezahlbare Wohnungen und so weiter. Ein Erfolgsfaktor dafür sind die Agglomerationsprogramme, die das ARE prüft und dem Bundesrat zur Mitfinanzierung vorschlägt.
Sie waren von 1996 bis 2001 stellvertretende Geschäftsführerin der Regio Basiliensis und leiteten danach die Hauptabteilung Planung im Hochbau- und Planungsamt des Kantons Basel-Stadt. Was nahmen Sie aus dieser Zeit für Ihre Tätigkeit in Bundesbern mit?
Eine eigene Sprache und eigene Verwaltungsverfahren sind zwar für mich selbstverständlich, aber nicht für meine Nachbarn. Wenn alle auf ihre eigenen Prinzipien beharren, finden sich keine Lösungen. Dies gilt einerseits für die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Sachbereichen, andererseits für die Zusammenarbeit über Kantons- und Ländergrenzen hinweg.
Zuletzt noch eine persönliche Frage: Was verbinden Sie mit der trinationalen Agglomeration rund um Basel?
Ich wohne immer noch im Kanton Baselland, das heisst im Handlungsraum «Trinationaler Metropolitanraum Basel» gemäss Raumkonzept. Und hier fühle ich mich wohl. Die Grenzschliessung zu Deutschland und Frankreich zu Beginn der Coronapandemie war für mich ein grosser Schock. Ich hoffe, dass wir sie nie mehr erleben werden.
Herzlichen Dank für das Interview!
Anmerkung: Der Konsultationsentwurf des aktualisierten Raumkonzepts Schweiz wurde veröffentlicht und befindet sich vom 5. Dezember 2024 bis zum 16. April 2025 in der öffentlichen Konsultation. Alle Akteure am Oberrhein, also auch jene aus Deutschland und Frankreich, sind eingeladen, sich zu beteiligen. Weitere Informationen